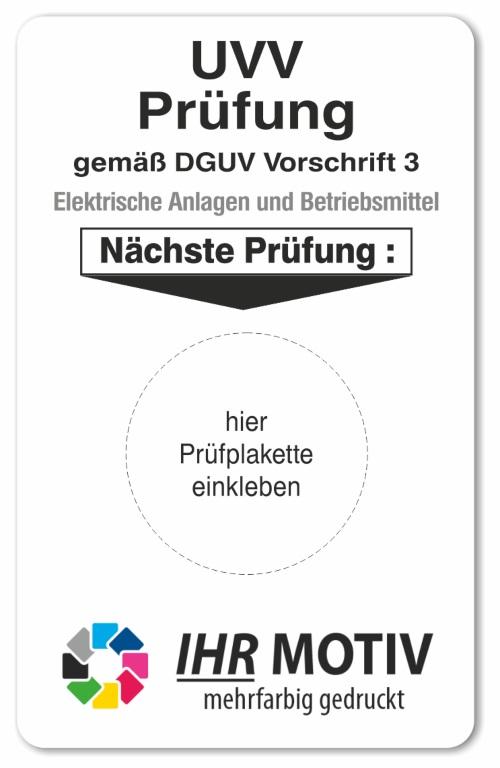« Infos zu Regeln und Kennzeichnung »
Ob in der Werkstatt, im Büro oder auf der Baustelle – die Sicherheit der Mitarbeiter hat höchste Priorität. Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geben Unternehmen klare Vorgaben, wie Arbeitsmittel geprüft und Risiken reduziert werden müssen. Doch was genau steckt dahinter, welche Vorschriften sind verbindlich, und wie läuft eine DGUV Prüfung in der Praxis ab? In diesem Beitrag erfahren Sie, was die wichtigsten Vorschriften bedeuten, wie Prüfungen dokumentiert werden – und wie Sie Ihr Unternehmen rechtssicher und effizient organisieren.
Warum UVV jeden Betrieb betreffen
Wenn Sie ein Unternehmen führen, kennen Sie die Herausforderung: Neben Aufträgen, Kunden und Mitarbeitern gibt es zahlreiche Vorschriften, die Sie beachten müssen. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Rein juristisch handelt es sich nicht um Gesetze, sondern um autonomes Satzungsrecht der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen auf Grundlage des Sozialgesetzbuchs VII (§ 15). Sie gelten jedoch für alle Unternehmen, die in der gesetzlichen Unfallversicherung organisiert sind – und das sind praktisch alle Betriebe in Deutschland. Damit sind die UVV für Unternehmer rechtsverbindlich einzuhalten.
Für Sie bedeutet das: Die Vorschriften liefern klare Vorgaben, wie Arbeitsplätze sicher gestaltet werden sollen – von der Organisation der Arbeitsmittel bis zur Ersten Hilfe. Wer sie konsequent umsetzt, schützt Mitarbeiter, vermeidet Ausfälle und ist im Schadensfall rechtlich auf der sicheren Seite. Wer sie ignoriert, riskiert Bußgelder und Regressforderungen.
Wer steckt hinter den Vorschriften – und was bedeutet DGUV?
Die Abkürzung DGUV steht für Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Sie ist der Dachverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die zusammen rund 70 Millionen Menschen in Deutschland gesetzlich unfallversichern.
Für Sie als Unternehmer ist vor allem wichtig zu wissen: Die Berufsgenossenschaften (BG) sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in der Privatwirtschaft. Sie erlassen die Unfallverhütungsvorschriften für ihre Mitgliedsunternehmen. Die Unfallkassen übernehmen dieselbe Aufgabe für den öffentlichen Bereich, also z. B. Schulen, Behörden oder Kitas.
Aktuell gibt es etwa 80 DGUV Vorschriften, die je nach Branche und Tätigkeit gelten können. Damit Sie als Unternehmer nicht den Überblick verlieren, ist Ihre zuständige Berufsgenossenschaft der erste Ansprechpartner: Sie gibt vor, welche Unfallverhütungsvorschriften für Ihren Betrieb maßgeblich sind.

Was ist der Unterschied zwischen DGUV Vorschrift und DGUV Regel?
Im Arbeitsschutz begegnen Unternehmern sowohl DGUV Vorschriften als auch Regeln. Auf den ersten Blick klingt das ähnlich, in der Praxis macht es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen: Was ist verbindlich – und was dient nur als Orientierungshilfe?
DGUV Vorschrift
Eine DGUV Vorschrift ist verbindlich. Sie legt fest, welche Schutzziele ein Unternehmen erreichen muss. Das betrifft zum Beispiel den sicheren Betrieb von Maschinen, den Umgang mit Arbeitsmitteln oder die Organisation von Erster Hilfe. Die wohl bekannteste ist die DGUV Vorschrift 1, die die allgemeinen Grundpflichten des Unternehmers definiert.
DGUV Regel
Eine DGUV Regel ist dagegen nicht verpflichtend, sondern bietet praktische Hilfestellungen. Sie beschreibt, wie die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften in der Praxis umgesetzt werden können. Regeln enthalten erprobte Methoden, die sich bewährt haben. Für Sie als Unternehmer heißt das: Wenn Sie sich an die Regeln halten, sind Sie in der Regel auch rechtlich abgesichert. Gleichzeitig bleibt es Ihnen erlaubt, andere Lösungen zu wählen – solange diese das gleiche Schutzziel erreichen.
Typische Inhalte der UVV – was Unternehmen konkret beachten müssen
Unfallverhütungsvorschriften bilden den rechtlichen Rahmen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie sind bewusst allgemein gehalten, damit sie branchenübergreifend anwendbar sind. So findet sich darin zum Beispiel die Forderung, dass Unternehmen für eine ausreichende Erste Hilfe sorgen oder nur sichere Arbeitsmittel einsetzen dürfen. Für sich genommen bleiben diese Vorgaben abstrakt, sie verdeutlichen jedoch die grundlegende Verantwortung der Betriebe.
Damit aus solchen allgemeinen Formulierungen konkrete Maßnahmen werden, greifen die begleitenden Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Sie übersetzen die Unfallverhütungsvorschriften in Handlungsanleitungen, die sich im Betrieb praktisch umsetzen lassen. So wird aus der Pflicht zur „sicheren Verwendung von Arbeitsmitteln“ die konkrete Vorgabe, dass elektrische Geräte regelmäßig geprüft, mit einer DGUV-Prüfplakette versehen und die Prüfergebnisse dokumentiert werden müssen. Genauso wird aus der allgemeinen Forderung nach „ausreichender Erste Hilfe“ die klare Anweisung, wie viele Ersthelfer im Verhältnis zur Belegschaft notwendig sind und wie diese geschult werden müssen. Die UVV definieren den rechtlichen Rahmen, während die Regeln und Informationen Unternehmen den Weg in die Umsetzung weisen. Dadurch entsteht ein System, das rechtliche Sicherheit gibt und zugleich nachvollziehbar erklärt, welche konkreten Schritte im Alltag notwendig sind – vom Prüfen der Maschinen bis zur Kennzeichnung von Fluchtwegen.
Was besagt die DGUV Vorschrift 1?
Die DGUV Vorschrift 1 trägt den Titel „Grundsätze der Prävention“ und ist so etwas wie das Fundament des Arbeitsschutzes in Deutschland. Sie gilt für alle Branchen und legt fest, welche Grundpflichten Unternehmer und Beschäftigte haben, um Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
Für Unternehmer bedeutet das vor allem: Sie müssen die Organisation im Betrieb so aufstellen, dass Sicherheit und Gesundheit jederzeit gewährleistet sind. Dazu gehören die Gefährdungsbeurteilung, die Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen, die Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter. Auch die Erste Hilfe – etwa durch die Benennung und Ausbildung von Ersthelfern – wird hier verbindlich geregelt.
Gleichzeitig verpflichtet die Vorschrift die Beschäftigten: Sie müssen die vorhandenen Schutzmaßnahmen einhalten, persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß nutzen und dem Arbeitgeber sofort melden, wenn ihnen Gefahren auffallen.
Die Vorschrift 1 hat damit eine Scharnierfunktion. Sie bündelt die allgemeinen Präventionspflichten und bildet die Grundlage für alle weiteren speziellen Verhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, wie etwa zur Nutzung elektrischer Anlagen (Vorschrift 3) oder zum sicheren Einsatz von Fahrzeugen (Vorschrift 70).

Wie viele DGUV Vorschriften gibt es?
Aktuell existieren rund 80 verschiedene DGUV Vorschriften, die jeweils unterschiedliche Gefahrenbereiche abdecken. Sie reichen von allgemeinen Regelungen wie den „Grundsätzen der Prävention“ (Vorschrift 1) bis hin zu sehr speziellen Themen – etwa zum Umgang mit Fahrzeugen (Vorschrift 70) oder zu Winden, zug- und Hubgeräten (Vorschrift 54).
Für Unternehmen bedeutet das allerdings nicht, dass sie jede einzelne Unfallverhütungsvorschrift im Detail beachten müssen. Welche Verhütungsvorschriften relevant sind, hängt stark von der jeweiligen Branche und den eingesetzten Arbeitsmitteln ab. Ein Handwerksbetrieb, der Fahrzeuge nutzt, muss die Vorschrift 70 beachten. Ein Industriebetrieb mit vielen elektrischen Anlagen hingegen ist bei der Vorschrift 3 besonders gefordert. Damit entsteht ein Baukastensystem: Die allgemeine Vorschrift 1 gilt immer, spezielle Unfallverhütungsvorschriften greifen je nach Betrieb zusätzlich. Unternehmen sollten daher genau prüfen, welche Vorschriften in ihrem Alltag tatsächlich relevant sind – und sich gegebenenfalls fachlich beraten lassen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Was bedeutet die DGUV Vorschrift 3?
Die Vorschrift 3 trägt den Titel „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ und zählt zu den wichtigsten Unfallverhütungsvorschriften überhaupt. Sie betrifft praktisch jedes Unternehmen, da nahezu überall elektrische Geräte oder Installationen im Einsatz sind – vom Computer bis hin zur komplexen Produktionsanlage. Diese Unfallverhütungsvorschrift schreibt vor, dass alle elektrischen Betriebsmittel regelmäßig geprüft werden müssen. Ziel ist es, Defekte frühzeitig zu erkennen und Unfälle wie Stromschläge oder Kabelbrände zu verhindern. Dabei wird unterschieden zwischen ortsfesten Betriebsmitteln (z. B. Maschinen, fest installierte Steckdosen) und ortsveränderlichen Betriebsmitteln (z. B. Verlängerungskabel, mobile Werkzeuge). Die Prüfungen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von qualifizierten Personen durchgeführt werden, die über die nötige Ausbildung und Erfahrung verfügen. In vielen Betrieben übernehmen das externe Prüfdienstleister, in größeren Unternehmen sind häufig eigene Fachkräfte dafür verantwortlich. Die Prüffristen richten sich nach der Art des Betriebsmittels und den betrieblichen Bedingungen. In Büros können längere Intervalle ausreichend sein, während in Werkstätten mit starker Beanspruchung kürzere Abstände vorgeschrieben sind. Entscheidend ist, dass der Unternehmer die Fristen auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung festlegt und dokumentiert. Am Ende der Prüfung werden die Geräte in der Regel mit einer DGUV Prüfplakette gekennzeichnet und ein Prüfprotokoll erstellt. Damit hat das Unternehmen nicht nur einen Überblick, wann die nächste Prüfung fällig ist, sondern auch einen rechtssicheren Nachweis im Falle eines Schadens.

Was muss nach DGUV Vorschrift 3 geprüft werden?
Die Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung verlangt, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nicht nur bei der ersten Inbetriebnahme, sondern auch in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Dabei geht es sowohl um die Sicherheit der Geräte selbst als auch um die Arbeitsumgebung, in der sie eingesetzt werden. Typische Fragen lauten: Funktionieren die Geräte zuverlässig? Sind Kabel, Stecker und Schutzschalter in Ordnung? Besteht durch beschädigte Leitungen oder unsachgemäße Nutzung eine Gefahr?
Die Prüfung darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Viele Unternehmen greifen dabei auf externe Prüfdienstleister zurück, andere bilden eigene Fachkräfte aus. Voraussetzung ist immer eine technische Ausbildung und praktische Erfahrung, wie sie in den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) gefordert werden.
Eine DGUV V3 Prüfung läuft in der Regel in drei Schritten ab:
- Sichtprüfung – Erkennen äußerer Schäden, etwa defekte Kabel oder unsichere Steckverbindungen.
- Funktionsprüfung – Kontrolle, ob das Gerät im Betrieb sicher arbeitet, z. B. ob Schutzschalter auslösen.
- Messprüfung – Überprüfung elektrischer Kennwerte wie Isolationswiderstand oder Schutzleiterwiderstand, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen.
Nach erfolgreicher Prüfung wird das Gerät mit einer DGUV Prüfplakette gekennzeichnet und ein Prüfprotokoll erstellt. Übrigens im Fachversand HERMANN direkt finden Sie alle Prüfplaketten und Basis-Aufkleber (Grundplakette), zum Nachweis der UVV Prüfung nach V3 – Elektr. Anlagen u. Betriebsmittel (BGV A3). So ist jederzeit nachvollziehbar, wann die nächste Prüfung fällig ist und dass die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift 3 eingehalten wurden.
Wer darf DGUV Prüfungen durchführen?
Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung schreibt eindeutig vor, dass Prüfungen nur von Personen durchgeführt werden dürfen, die über die erforderliche Fachkenntnis verfügen. In der Praxis unterscheidet man dabei zwei Gruppen:
- Elektrofachkräfte: Sie verfügen über eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung und ausreichende praktische Erfahrung. Damit sind sie grundsätzlich befähigt, alle Arten von DGUV V3 Prüfungen selbstständig durchzuführen.
- Befähigte Personen: Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter, die keine vollständige elektrotechnische Ausbildung haben, aber durch zusätzliche Schulungen und nachweisbare praktische Erfahrung in der Lage sind, bestimmte Prüfungen sicher vorzunehmen. Sie müssen jedoch von einer Elektrofachkraft eingewiesen und beaufsichtigt werden.
Unternehmen können die Prüfungen entweder intern organisieren – indem sie eigene Mitarbeiter qualifizieren – oder externe Prüfdienstleister beauftragen. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Qualifikation dokumentiert wird und die Prüfer die Vorgaben der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) erfüllen.
Kennzeichnung & Prüfplaketten – praktische Umsetzung
Nach einer erfolgreich bestandenen Prüfung werden die geprüften Anlagen oder Geräte in der Regel mit einer Prüfplakette versehen. Diese dient als sichtbarer Nachweis für den letzten Prüfzeitpunkt und erinnert gleichzeitig an den nächsten Termin. Viele Unternehmen nutzen dafür Jahresfarben, die sich im festen Rhythmus wiederholen. Der Vorteil: Auf einen Blick ist erkennbar, aus welchem Jahr die letzte Prüfung stammt – das erleichtert die Übersicht über fällige Nachprüfungen erheblich. Entscheidend ist, dass die Plakette gut sichtbar angebracht wird, zum Beispiel direkt am Gerät oder auf einer Grundplakette. So behalten Unternehmen und Prüfer langfristig den Überblick.
Wichtig ist: Eine Plakette allein reicht nicht aus. Ergänzend muss der Betrieb ein Prüfprotokoll führen. Darin werden Prüfdatum, Art der Prüfung, verantwortliche Fachkraft sowie festgestellte Mängel und deren Beseitigung dokumentiert. Dieses Protokoll gilt als offizieller Nachweis im Falle eines Unfalls oder einer Kontrolle – und sollte deshalb sorgfältig aufbewahrt werden. Obwohl das Anbringen einer Plakette nicht verpflichtend ist, hat es klare Vorteile. Neben der Terminübersicht vermittelt sie auch ein sichtbares Signal für Sicherheit und Verlässlichkeit – sowohl für Mitarbeitende als auch für Kunden, die den Betrieb besuchen.
 HERMANN Fachversand
HERMANN Fachversand